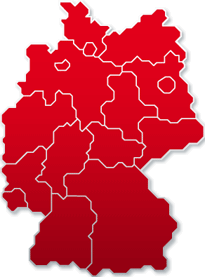Über den Umgang mit dem Faschismus in der DDR
Mahnmal Buchenwald
Berlin (Korrespondenz): Im Potsdamer Abkommen vom 2. 8. 1945 heißt es, dass die nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen Gliederungen zu vernichten ist. Es sind Sicherheiten dafür zu schaffen, „dass sie in keiner Form wieder auferstehen können; jeder nazistischen und militaristischen Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen“. Dieses Abkommen wurde nur in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) umgesetzt.
Auf der Grundlage der Entnazifizierung, der Enteignung der Betriebe von Kriegs- und Naziverbrechern sowie von Großgrundbesitzern wurde eine antifaschistisch-demokratische Ordnung errichtet. Aus dieser ging 1949 die DDR hervor.
Noch vor der Staatsgründung wurde in der SBZ die Entnazifizierung abgeschlossen, durch die der gesamte Verwaltungsapparat, die Justiz, das Schulwesen und die Industrieverwaltungen rigoros von Mitgliedern der Hitlerpartei und deren Organisationen gesäubert wurden. Insgesamt wurden auf diesem Wege etwa 520.000 Personen entlassen, die, soweit sie nicht in den Westen abwanderten, eine Arbeit in der Industrie zugewiesen bekamen. An ihre Stelle traten Volksrichter, Volkslehrer, Volkspolizisten in den Staatsdienst ein und sorgten dort für einen antifaschistischen Neuanfang.
Gedenkorte
Überall in der DDR, wo gegen die Faschisten gekämpft worden war, aber auch dort, wo der Faschismus Opfer in der nichtkämpfenden Bevölkerung gefordert hatte, wurden lokale Gedenktafeln aufgestellt, oft mit konkreten biographischen Daten der Toten. Später wurden diese Tafeln in Text und Gestaltung leider standardisiert. In den Jahren 1959 bis 1961 kam es zur Errichtung von drei großen antifaschistischen Mahn- und Gedenkstätten – in Buchenwald bei Weimar, in Sachsenhausen bei Berlin und in Ravensbrück, dem Standort des einzigen Frauen-KZs auf deutschem Boden.
Die Bevölkerung spendete erhebliche Summen und beteiligte sich in vielen Sonderschichten am Bau der Gedenkstätten. Alljährlich fanden hier große antifaschistische Kundgebungen und Massenaufmärsche statt. Der Besuch einer dieser Gedenkstätten war eine Pflichtveranstaltung für die Schüler, manchen lästig, vielen ein nachhaltiges Erlebnis. In der BRD hat es eine derartige Masseninitiative beim Bau von Gedenkstätten in dieser Zeit nicht gegeben.
NS-Prozesse in der SBZ/DDR
Bereits wenige Jahre nach der faschistischen Kapitulation fanden große und kleine NS-Prozesse statt, oft an den Orten des verbrecherischen Wirkens der Täter und unter reger Anteilnahme der Bevölkerung. So wurde im April 1948 in Görlitz ein Volksgerichtsprozess gegen den „Tyrannen von Görlitz“ durchgeführt, Dr. Hans Meinshausen, Goebbels Stellvertreter als Berliner Gauleiter. Einer der 25 Zeugen war der frühere Berliner KPD-Chef Walter Ulbricht, der Anfang der 1930er Jahre die Knüppel von Meinshausens Schlägerkolonnen zu spüren bekommen hatte. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde Meinshausen zum Tode verurteilt und im Oktober 1948 hingerichtet. Der Meinshausen-Prozess war kein Einzelfall. Ein wissenschaftlicher Vergleich der ost- und westdeutschen NS-Prozesse, durchgeführt von einem niederländischen Forscher, führte zu dem Ergebnis, dass die ostdeutschen Gerichte mehr gegen NS-Verbrecher unternommen haben als die Kollegen im Westen. „Sie haben deutlich mehr Täter früh aufgespürt, angeklagt und verurteilt. Bis 1960 war die DDR mit 88 Prozent ihrer NS-Prozesse fertig, die westdeutsche Justiz erst mit 55 Prozent. Die im Osten Angeklagten erhielten wesentlich höhere Strafen und wurden von jeder Amnestie ausgenommen, es gab weniger Freisprüche und Einstellungen.“ (Heiner Lichtenstein: Zwischen Todesstrafe und Amnestie NS-Prozesse in den beiden deutschen Staaten, www.polen-news.de/puw/puw66-26.html)
Mehr Prozesse – das bedeutet auch mehr öffentliche Aufklärung über den Faschismus und mehr öffentliche Diskussionen.