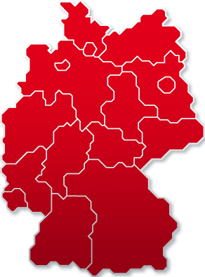Wenn tödliche Viren auf menschenfeindliches Sicherheitsdenken treffen
Dr. Andreas Wulf, foto: privat
Interview mit Dr. Andreas Wulf, medizinischer Projektkoordinator von „medico international“
Können Sie unseren Lesern kurz die Natur des Ebola-Virus erklären?
Es ist ein Virus, das zu einer Gruppe von Viren gehört, die sehr gefährlich sind und zu
den sogenannten Hämorrhagischen Fiebern führen. Das sind schwere fiebrige Infektionskrankheiten, die zu schweren Blutungen der inneren Organe und damit auch zum Tod der Menschen führen. Es ist ein Virus, das von Tieren, die im Urwald leben, auf den Menschen übertragen wird.
Deshalb gibt es immer wieder solche Ausbrüche in zumeist entlegenen ländlichen Gebieten, wenn die Menschen in Kontakt mit solchen Tieren kommen. Es hatte in der Vergangenheit vor allem kleine Ausbrüche in zentralafrikanischen Gebieten gegeben, die sich nicht weiter ausgebreitet haben, weil die Bevölkerung insgesamt und die Mobilität der Menschen dort nicht so hoch war.
Das ist jetzt in Westafrika anders, weil es eine größere Mobilität auch über Grenzen hinweg gibt und deshalb die Ausbreitung stärker ist. Ein zweiter Faktor ist, dass es verschiedene Arten von Virenstämmen gibt, die unterschiedlich gefährlich sind, was die Todesrate betrifft. Das führt einerseits dazu, dass aktuell mehr Menschen überleben, unglücklicherweise dann auch wieder dazu, dass sich das Virus jetzt weiter verbreiten konnte.
Woher kommt Ihrer Meinung nach die derzeit rasante Ausbreitung?
Zu diesen eben erwähnten epidemiologischen Gründen kommen weitere soziale und gesellschaftliche Aspekte. Besonders wichtig ist, dass die klassischen Eindämmungsmechanismen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, die Hygienemaßnahmen unter den Mangelerscheinungen des dortigen Gesundheitswesens nicht entsprechend funktioniert haben, was natürlich wiederum vor allem an den fehlenden Ressourcen des dortigen Gesundheitssystems liegt.
Das wäre nun die nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielen die sozialen Verhältnisse vor Ort?
Das ist ganz wesentlich. Die öffentliche Gesundheitsversorgung ist miserabel bis nicht existent. Die drei betroffenen Länder Sierra Leone, Nigeria und Liberia gehören zu den ärmsten Ländern innerhalb des afrikanischen Kontinents. Damit sind natürlich auch die Ressourcen, die im Gesundheitssystem zur Verfügung stehen, entsprechend gering. Die materielle Ausstattung ist gering, schon Schutzkleidung und Gummihandschuhe fehlen häufig, insgesamt ist viel zu wenig Personal vorhanden. Dadurch können solche Krankheitsfälle nicht entsprechend versorgt werden, die Ärzte und das Pflegepersonal sind selbst hohen Infektionsgefahren ausgesetzt und tragen selbst zur Verbreitung der Erkrankung bei. Auch dass erst nach Monaten die Frage auftaucht, wie viel Geld man aktuell braucht, um die Epidemie zu bekämpfen, ist ein Zeichen dafür, dass man darauf gar nicht vorbereitet ist.
Welche Rolle spielt die Information der Bevölkerung vor Ort?
Das ist zum einen die Frage, wie gut die Information überhaupt funktioniert, aber auch welches Vertrauen die Bevölkerung in die staatliche Information hat, wenn der Staat auf dem Hintergrund von zahlreichen Bürgerkriegen überhaupt nicht als verlässlicher Informationspartner in Erscheinung tritt. Sondern eben als Staat, der repressive Maßnahmen ergreift, bis dahin, dass dann Militär eingesetzt wird, um die Bevölkerung am Verlassen ihrer Wohnviertel zu hindern. Deshalb ist es nicht nur die Frage, bekommen die Menschen die Information, sondern kann sie überhaupt vertrauensvoll aufgenommen werden und welche Strukturen sind in solchen Ländern vorhanden, die eine entsprechende Aufklärungsarbeit leisten können – denen die Menschen auch vertrauen.
Wir von „medico international“ arbeiten deshalb in Sierra Leone, wo wir auch tätig sind, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Partnern direkt vor Ort zusammen. Weil wir darin eine bessere Möglichkeit sehen, während die offiziellen Gesundheitsleute, die häufig aus der Hauptstadt sind, oft eine größere Distanz zur Bevölkerung haben. Das ist eine wichtige Forderung, die wir auch immer stellen, dass diese Art von gesellschaftlicher Teilhabe der betroffenen Menschen selbst hergestellt werden muss.
Das Virus ist ja seit 1976 bekannt? Warum fehlen Ihrer Meinung bis heute wirksame Medikamente?
Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass das Virus bislang tatsächlich in sehr kleiner Häufigkeit aufgetreten ist und damit so auch nicht in der breiten internationalen Diskussion eine der Hauptfokusse der Forschung und Entwicklung war. Wir wissen natürlich auch, dass der Verlass auf die hauptsächlich kommerzielle Erforschung von Medikamenten und Impfstoffen bedeutet, dass sie nach den zu erwartenden Erträgen ausgerichtet wird. So dass gerade diese Art von bisher eher seltenen Tropenkrankheiten so gut wie gar nicht von privaten Pharma-Unternehmen beforscht wird. Und die öffentliche Forschung, die es auch gibt, konzentriert ihre eher beschränkten Möglichkeiten auf andere Krankheiten. Deshalb ist es eine wichtige Forderung, dass eine entsprechende öffentliche Forschung auch in öffentliche Hände gehört und somit nicht so eine Verzerrung von Forschungsschwerpunkten stattfindet, die sich auf zahlungskräftige Gruppen, Krankheiten und Gesundheitsdienste orientieren.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Maßnahmen, um mit dem Problem fertig zu werden?
Uns ist es immer wichtig zu betonen, dass man eben nicht erst handelt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Man muss darauf schauen, dass die Gesundheitsdienste perspektivisch besser finanziert und organisiert werden. Hier muss es viel verlässlichere, dauerhafte internationale solidarische Finanzierungen für die ärmsten Länder geben als bisher. Es spielen natürlich auch weitere ökonomische und gesellschaftliche Grundbedingungen eine Rolle, die dazu führen, dass Menschen solchen spezifischen Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind. Etwa dadurch, dass in diesen Regionen zunehmend fruchtbare Ackerböden durch Großkonzerne aufgekauft und Kleinbauern so in die Urwaldgebiete auf der Suche nach Nahrung und neuen Anbauflächen gedrängt werden.
Aktuell notwendig ist es natürlich, dass die lokalen Regierungen unterstützt werden. Problematisch ist dies aber dann, wenn sich der herrschende Sicherheitsdiskurs durchsetzt, der das Problem in erster Linie vor Ort isolieren will, damit sich die Epidemie nicht „bis zu uns“ ausbreitet. In diesem Sinne ist die Einstellung der Flugverbindungen ein hochproblematisches Symbol, das nicht nur konkret die lokale Wirtschaft schädigt, sondern auch signalisiert, dass man die Leute allein lässt und nicht unterstützt.
Es gibt aber auch in der letzten Zeit einige positive Beispiele. Kuba hat jetzt eine große Unterstützung angekündigt, eine Gruppe von 150 Leuten medizinisches Fachpersonal, das sehr gut ausgebildet ist, und materielle Güter geschickt. Das ist gut und wichtig. Problematisch finden wir, dass die Hilfe in anderen Fällen gleich an das Militär delegiert wird, die USA etwa mit militärischem medizinischem Personal und mit Soldaten antworten. Problematisch ist natürlich auch, dass die Aufrufe der Weltgesundheitsorganisation WHO nach aktiver Hilfe von ihren Mitgliedsländern doch nur sehr spärlich beantwortet werden. Zumal die WHO als Antwort auf die besonders durch die wohlhabenden Mitgliedsländer verursachten Budgeteinschränkungen ihre Kapazitäten in der Infektionsbekämpfung selbst einschränken musste.
Zudem kommt, dass natürlich auch immer eine eigene große Gefährdung für das medizinische Personal vor Ort vorhanden ist, eine signifikante Zahl hat sich doch selbst infiziert und viele sind schon gestorben. Zu einem solchen hohen persönlichen Einsatz, auch in den Ländern selbst, dorthin zu gehen, sind nur wenige Helfer bereit; das muss natürlich weiter gefördert werden. Skandalös finden wir in dem Zusammenhang, dass etwa aus Liberia Berichte kommen, dass medizinisches Personal nach Monaten in den Streik treten musste, weil es trotz der angekündigten vielen Millionen Dollar Hilfsleistungen nicht richtig bezahlt wurde. Das ist natürlich ein Armutszeugnis sowohl der lokalen Regierungen wie der großen internationalen Organisationen und großen Länder, die schnell dabei sind, große Hilfen zu versprechen, während die aktive Umsetzung doch sehr viel langsamer geschieht.
Vielen Dank für das Gespräch.