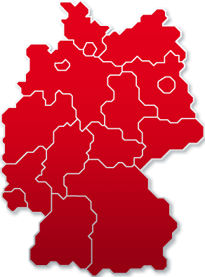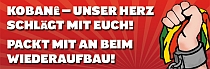„Pille danach“ endlich rezeptfrei
Woher kommt der vehemente Widerstand gegen die „Pille danach“?
München (Korrespondenz): Der Beschluss der Bundesregierung von diesem März, die „Pille danach“ aus der Rezeptpflicht zu nehmen, setzt einen vorläufigen Schlusspunkt unter eine unendliche Geschichte.
Die Auseinandersetzung zog sich seit 2003 hin. Schon vor zwölf Jahren empfahl der beratende Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht die Entlassung der „Pille danach“ aus der Rezeptpflicht. Die ganze Problematik erregte 2013 bundesweit Aufsehen in der Öffentlichkeit, nach dem zwei Kölner Kliniken unter katholischer Trägerschaft einer offensichtlich vergewaltigten Frau die Hilfe verweigerten. Sie taten dies mit dem Verweis auf die „ethischen Grundsätze“ des katholischen Trägers, der die geforderte Abgabe der „Pille danach“ untersagte. Durch die unterlassene Hilfeleistung nahmen sie eine mögliche Schwangerschaft des Vergewaltigungsopfers billigend in Kauf. Der darauf losbrechende Proteststurm setzte letztendlich die Bundesregierung unter Druck, sodass es nun zu der Entschließung kam. Deutschland reiht sich mit diesem längst überfälligen Beschluss in die Mehrheit der europäischen Länder ein, in denen Rezeptfreiheit längst Sachstand ist. Nur Polen, Italien und Ungarn verharren noch im rezeptpflichtigen Zustand. Durch die Beschlusslage in anderen Ländern (in Frankreich seit 1999) wurde die unwissenschaftliche und reaktionäre Argumentationslinie der Gegner immer brüchiger.
Besonders die Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. „Pro Familia“ wirkte mit Entschiedenheit und Fachkompetenz als Sprachrohr für die Frauen. Der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) hingegen lehnte eine Rezeptfreiheit gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ab. Begleitet wurde die Ablehnung von einem Chor konservativ-reaktionärer Politiker und kirchlicher Verbände. Auch die katholischen Frauen- bzw. Beratungsverbände stützen mit ihren Stellungnahmen gegen die Rezeptfreiheit diese rückständige Richtung in beschämender Weise. So dämonisierte „Donum vitae“ (katholische Schwangerenberatung) den Wirkstoff als ein „hochdosiertes Hormonpräparat“, es sei deshalb gesundheitsgefährdend. Weiter befürchteten sie, dass die Pille danach völlig „unkontrolliert, beliebig oft, ab Beginn der Geschlechtsreife“ von Frauen und Mädchen genutzt werden könnte. Da gerät so ein Verband schon einmal in eine Sinnkrise, wenn ihm die Kontrolle der weiblichen Sexualität aus den Finger gleitet.
Die „Pille danach“ ist keine „Abtreibungspille“, sie wirkt daher auch nicht, wenn eine Schwangerschaft bereits besteht. Tatsächlich handelt es sich bei der „Pille danach“ um ein relativ gut verträgliches Arzneimittel. Es hat eine hohe Wirksamkeit, wenn der schnelle unkomplizierte Zugriff, ohne künstlich aufgebaute Hürden, unnötige Arztkonsultationen und Untersuchungen gewährleistet ist.
Verhütungspannen lassen sich nicht vermeiden, sie sind normale und zu erwartende Ereignisse im Leben von Frauen und Männern. Gehäuft treten sie im Jugendalter auf. Nach wie vor ist es in erster Linie Sache der Mädchen und Frauen, zu verhüten. Das macht Fragen des verantwortlichen Umgangs mit Sexualität und Verhütung ohne Zweifel auch zu wichtigen Themen unter und gegenüber der Jugend.
Der vehemente Widerstand gegen den freien Zugang zur „Pille danach“ hat seine Ursache im herrschenden Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem, dessen Bestandteil die besondere Unterdrückung der Frau und die Kontrolle ihrer Sexualität ist. Besonders die Kirchen und reaktionär-konservative Kreise bestehen auf der engen Bindung der Sexualität nur zum Zwecke der Erzeugung ehelicher Kinder. Aus diesem Grund hält die katholische Kirche nach wie vor an ihrem Bannstrahl gegen Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch und Ehescheidung fest. Besonders mit dem sichtbar werdenden Zynismus gegen die Frauen – Hilfeverweigerung aus „ethischen Gründen“ – verloren sie an Glaubwürdigkeit.